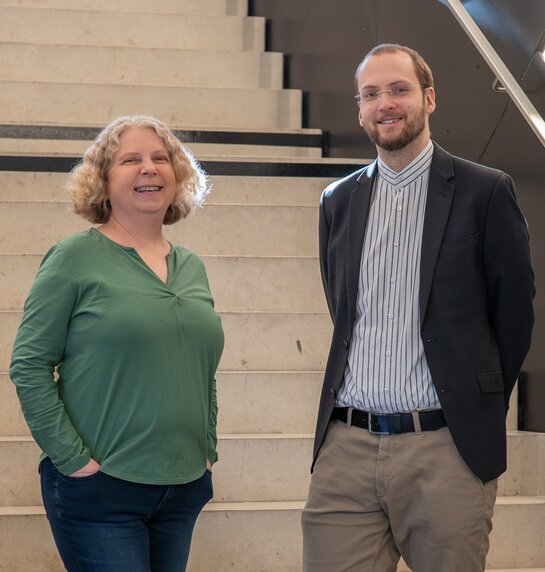Ariadne auf Naxos: ein Künstlerporträt

Die Ausgangssituation ist schnell erklärt: Ein junger Komponist hat seine erste Oper geschrieben, die nun «im Hause des reichsten Mannes von Wien» zur Uraufführung kommen soll. Doch der schwer gelangweilte Mäzen hat sich als «heiteres Nachspiel» eine Commedia-Truppe eingeladen, deren Tanzmaskerade «Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber» kurzerhand mit der heroischen Oper Ariadne fusioniert wird. Das Stück beginnt und die Komödiant:innen mischen sich ungefragt in die tragische Opernhandlung ein.
Die zugrundeliegende Struktur von Strauss‘ Ariadne auf Naxos ist ein klassisches Stück im Stück. Nicht nur das: Wir erleben im Vorspiel den Autor der Oper, die uns anschließend inklusive Ouvertüre und großem Schlussfinale vorgeführt wird. Und auch die Darsteller:innen beider Stücke – der heroischen Oper und der Stehgreifkomödie – lernen wir kennen und von ihren Rollen in der Opernhandlung unterscheiden, wobei Zerbinetta, wie wir erfahren, ohnehin «immer nur sich selber spielt».
Man soll zwar vom Autor nicht auf sein Werk schließen – doch kommt man in dieser besonderen Konstellation gar nicht umhin, die zentralen Themen der Oper auf die Konflikte und Personen des Vorspiels zu beziehen. Umso mehr, als sich diese Konflikte durch die Einmischungen Zerbinettas in der Opernhandlung fortsetzen. Während Ariadne in ihrem einsamen Exil auf Naxos ihren Erinnerungen an den untreuen Theseus nachhängt, stört Zerbinetta mit ihrer Truppe die Trauerszene durch eine beschwingte Rede auf die ewig neuen Möglichkeiten wechselnder Liebhaber. Ariadne solle sich ganz einfach den nächsten anlachen!

Diese Oper ist kein in Stein gemeißeltes Werk auf schneeweißem Büttenpapier. Sie ist ein Stück lebendiges Theater.
Man soll zwar vom Autor nicht auf sein Werk schließen – doch kommt man in dieser besonderen Konstellation gar nicht umhin, die zentralen Themen der Oper auf die Konflikte und Personen des Vorspiels zu beziehen. Umso mehr, als sich diese Konflikte durch die Einmischungen Zerbinettas in der Opernhandlung fortsetzen. Während Ariadne in ihrem einsamen Exil auf Naxos ihren Erinnerungen an den untreuen Theseus nachhängt, stört Zerbinetta mit ihrer Truppe die Trauerszene durch eine beschwingte Rede auf die ewig neuen Möglichkeiten wechselnder Liebhaber. Ariadne solle sich ganz einfach den nächsten anlachen!
Die Szene ist die metaphorische Fortsetzung der entscheidenden Konflikte im Vorspiel. Hier ist es der Komponist, der sich mit Zerbinettas «untreuem» Lebenswandel konfrontieren muss. Sein erster Eindruck ist dabei durchaus günstig: «Wer ist dieses entzückende Mädchen?», fragt er seinen Musiklehrer. Erst als er erfährt, was seiner Oper blüht und welche Rolle eben jenem Mädchen in dem Fiasko zugedacht ist, ändert er seine Ansichten. Doch Zerbinetta hat ihre eigenen Pläne. «Und wenn ich hineinkomme, wird’s [das Stück; A.d.V.] schlechter?», fragt sie den Komponisten, nur um ihn daraufhin gekonnt und «mit äußerster Koketterie, scheinbar ganz schlicht» um den kleinen Finger zu wickeln, indem sie von sich selbst als einer tragischen Gestalt spricht. Während sie munter «scheine», sei sie doch in Wirklichkeit traurig und sehne sich «nach dem einen, dem sie treu sein könnte […] bis ans Ende».
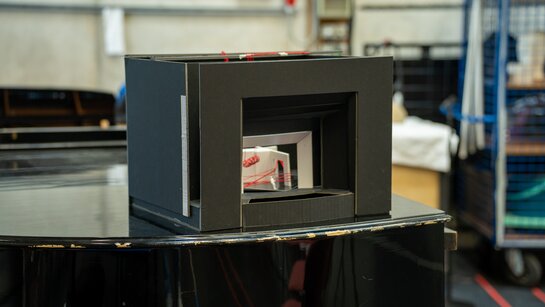
Der Komponist, für den die Welt in Heilige und Unheilige, in Zerbinettas und Ariadnes zerfällt, glaubt, die Frau seiner Träume vor sich zu sehen: «Du bist wie ich, das Irdische unvorhanden in deiner Seele». Doch Zerbinetta eilt zum Auftritt und in die Arme ihrer vier Compagnons, die sie mit den üblichen unflätigen Grimassen der Commedia dell’Arte begrüßen. Keine Tragödin, sondern eine Frau so durch und durch von dieser Welt, die dem Komponisten dermaßen zuwider ist, dass er lieber in seiner eigenen «erfrieren, verhungern, versteinern» möchte, als sich kompromissweise mit ihren Zumutungen zu arrangieren. So endet das Vorspiel, das Stück im Stück. Die Oper beginnt, der Vorhang hebt sich auf eine wüste Insel und die in Trauer versteinerte Ariadne. Doch die Komposition werden wir nicht erleben, wie sie gedacht war. Nichts ist wie geschrieben oder geplant. Durch die Einmischung Zerbinettas hat auch in der Oper das Leben seine Finger im Spiel, lassen sich Begegnungen nicht vermeiden und scheint die kompromisslose Operntragik oft geradezu komisch – nur um dann doch ihre «Flügel zu schwingen». Diese Oper ist kein in Stein gemeißeltes Werk auf schneeweißem Büttenpapier. Sie ist ein Stück lebendiges Theater.
TEXT Katharina Duda
BILD Raphael Gutleben